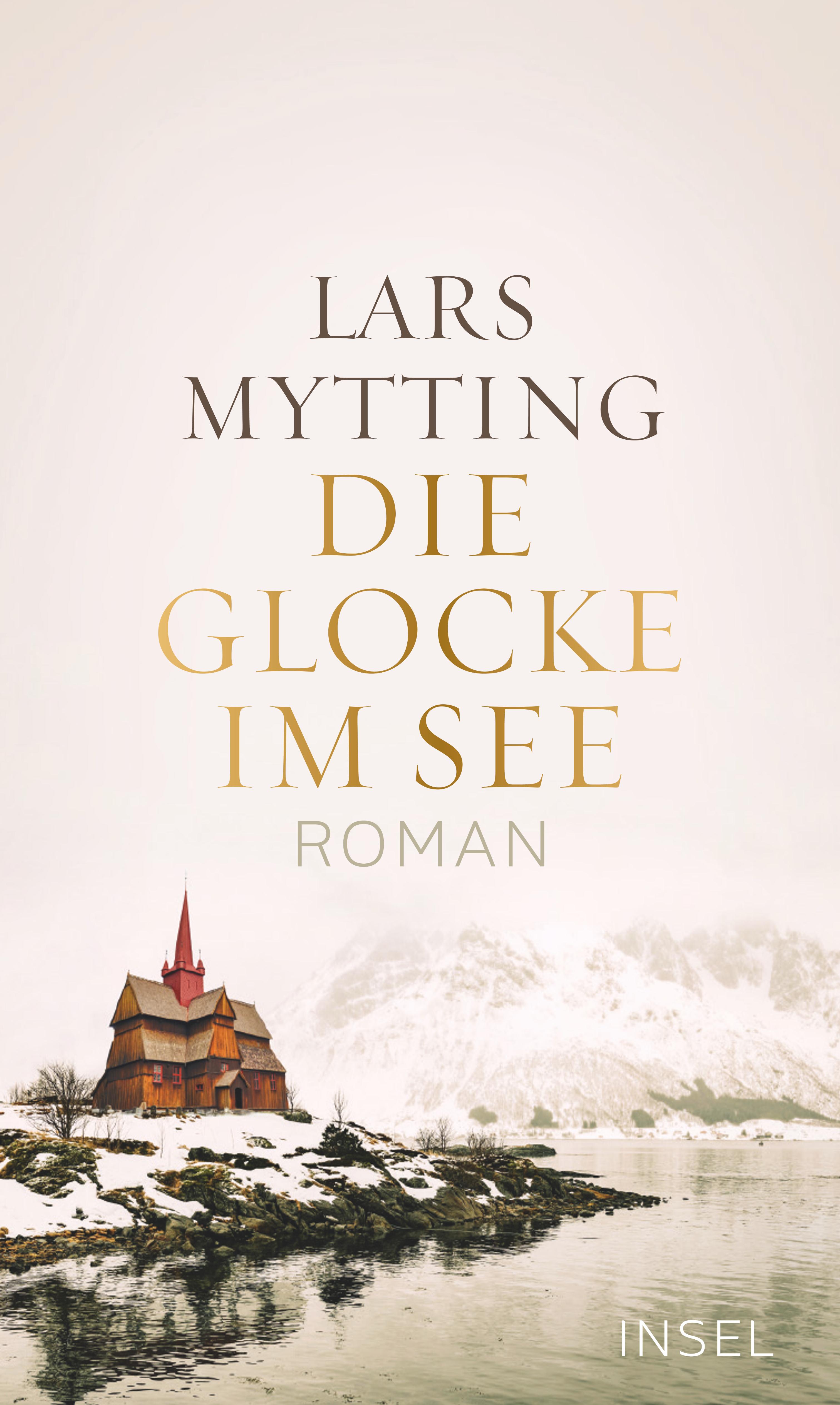Unangenehm, ein bisschen sperrig, gespickt von trutzig-teutonischer Lyrik, verwirrend und für mich nicht durchgängig witzig ist die Satire „Zornfried“ von Jörg-Uwe Albig über den Journalisten Jan Bröck, der sich bei Recherchen zum Dichterfürsten Storm-Linné der Neuen Rechten zu verlieren droht.
Nichts der im Buch erdachten Orte und Personen ist real, man könnte beim Lesen des Namens Zornfried mit seinem Burgherrn von Schierling zwar an Götz Kubitschek und das Rittergut Schnellroda denken. Doch vermutlich ist sowohl Burgname ein spielerischer Hinweis ebenso wie der Dichtername Storm Linné, zusammengesetzt aus Theodor Storm und Carl von Linné, dem aus Schweden stammenden Begründer der Klassifizierung von Pflanzen, was nach Aussage des Autors Albig irgendwie zur Rechten passen würde - Einteilung, Klassifizierung in Rassen. Namentlich ebenso symbolträchtig erscheint mir Freiherr von Schierling, Burgherr von Zornfried, namensgebend hier die giftigste Pflanze Deutschlands und alte Tötungsmethode - der Schierlingsbecher. Dazu gesellen sich mit Freya, Burglinde oder Teutonia als austauschbare Töchter von Schierlings und seiner Ehefrau Brigitte.
Ergänzt wird die illustre Gesellschaft von Computer-verspeckten Möchtegern-Kämpfern, die im Burghof brüllen und sich schlagen, sich bei einer Antifa-Demo vor den Mauern der Burg gemeinsam mit den Burgbewohnern und reichlich Sekt auf dem Burgturm verschanzen, fröhlich ihre Unerreichbarkeit als Sieg feiernd, von Juristen, Studienräten, Burschenschaftlern, und böse-genialen Filmemachern die sich regelmäßig zur Tafelrunde und Gedichtrezitation Storm-Linnés versammeln.
Dazwischen bewegen sich der Journalist Jan Brock und die Journalistin Jenny Zerwien von der Konkurrenz auf ihrer Reportagereise wie zwei Fremdkörper inmitten all des Deutschtums, beide Gefahr laufend, die Orientierung zu verlieren inmitten all der Teutonik, abstoßend und zugleich faszinierend weihevollen Waldgängen, Kampfesproben. Für Jan Brock drohen sich die Grenzen zwischen Beobachtung aus Abstand und dem Willen nach Teilnahme und Zugehörigkeit zu verwischen, doch in seinem allabendlichen Rückweg zum Gasthaus im nahegelegenen Wuthen verschafft er sich mit (ebenso erdachter) Musik von Shit Tsunami oder Braineaters wieder seine Erdung.
Mehrere Tage begleitet Brock als freier Journalist den Burgherrn von Schierling auf dessen Einladung, nachdem er einen kruden Verriss der Lyrik von Storm-Linné verfasste, um einen intensiveren Eindruck vom schwülstig teutonisch-weihevollen Dichter Storm Linné zu erhaschen, mit angeborener Neugier und getreu seinem Motto, dass man über alles, was es gibt, schreiben muss, getreu seinen Vorbildern im Gonzo-Journalismus, die mit Rockern kifften und prügelten, um über sie zu berichten. Im Geiste ein solcher Rebell stolpert er dennoch in die Fallstricke, die seit Jahren von der Rechten ausgelegt werden, nämlich Publicity um jeden Preis zu bekommen. Er beginnt an den rechten Ritualen teilzunehmen, unbemerkt nickend, auf dem Burgturm heimlich am Sekt nippend, immer in der Hoffnung, dass es nicht gesehen und bemerkt wird...und er verschafft den Rechtsintelektuellen Vordenkern zumindest zeitweise genau das, was sie wollen.
Richtig unheimlich und gruselig, markig-romantisch und erdig-blutig ist die kleingeschriebene Lyrik, die Jörg-Uwe Albig für den Roman schuf:
„Und wenn auch brunst-geschmeiß und vieh die kirchen fluten
Wenn hass aufs eigne schrill von den altären klingt
Wenn üble priester mann und mann vermählen
Und grauser chor der massen herrschaft singt
So bleibt uns doch der größte dom von allen
Wo wahrhaft frommer sang durch kuppeln hallt
Wo licht durch säulen bricht und grüne ornamente
So bleibt uns doch der ewig deutsche wald“
Zum Glück umgibt diese mystifizierenden Gedichte mit perfektem Versmaß und Rhythmus eine bitterböse Satire, andernfalls könnten sie durchaus aus der Ultra-rechten Ecke stammen.
Und natürlich ist der Roman trotz aller satirischen Persiflage auf die Homestories aus Schnellroda von einer entscheidenden Grundfrage geprägt: Wie weit darf journalistische Neugier gehen?
Ich fand es nicht ausschließlich witzig, was ich gelesen habe. Aber gelesen werden muss dieses Buch meiner Meinung nach. An hellen Sonnentagen und weit weg vom Wald.
Zornfried von Jörg-Uwe Albig
Roman gebunden, 208 Seiten
Verlag: Klett-Cotta
Erschienen am 28.02.2019
ISBN 9783608964257
Preis 20€