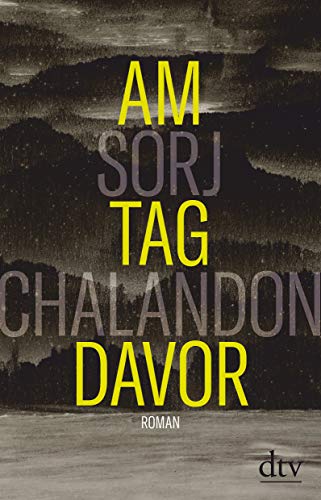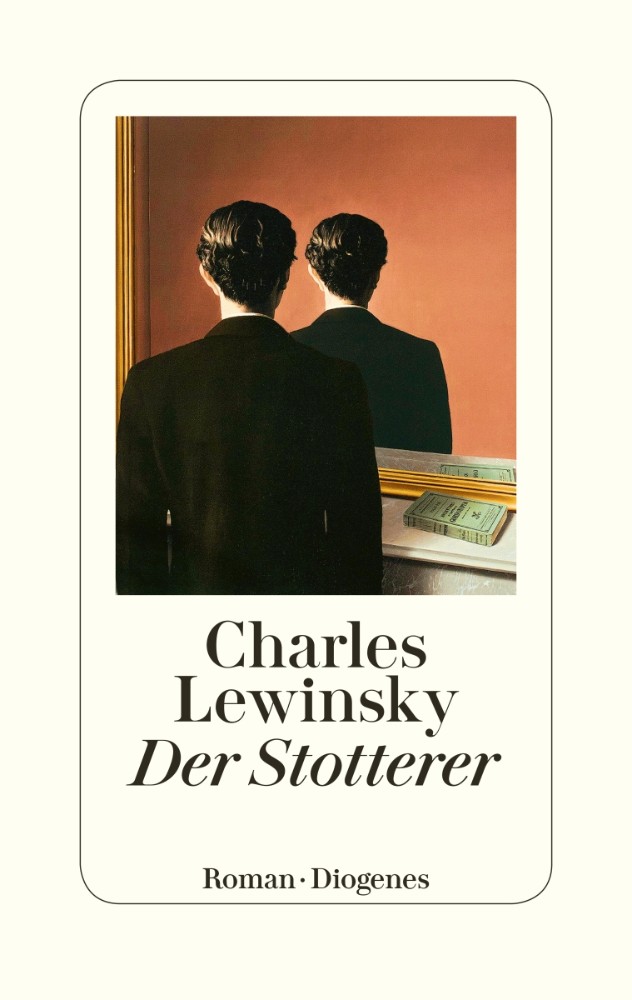Der koreanische Autor Hwang Sok-Yong entführt den Leser in seinem Werk „Die Lotosblüte“ ins 19. Jahrhundert in die konfliktreiche Zeit des Taiping-Aufstandes, der politischen Verwicklungen zwischen China, den Briten, Amerikanern und den Japanern.
Vor diesem Hintergrund rollt der Autor die Geschichte der Koreanerin Chong Shim auf, die mit 15 Jahren von ihrer Stiefmutter an einen Mädchenhändler verkauft wird. Sie kommt zu einem 80jährigen Chinesen nach Nanking, dem sie als Zweitfrau Lebenskraft spenden soll und wo sie den Namen Lotosblüte erhält. Später im Bordell ausgebildet, geraubt und wieder verkauft ist ihr „Lotosweg“ mit Stationen in Taiwan, Singapur, Nagasaki, den Ryukyu-Inseln und Satsuma von Namenswechseln begleitet.
Nach ihrem ersten Wandel auf ihrer Reise nach China, auf der sie einer koreanischen Legende gemäß dem Meeresgott begegnet und als andere Person aus dem Meer auftaucht, passt sich Chong Shim Chamäleon-artig den veränderten Gegebenheiten an, wechselt mit jeder Station den Namen und schafft es, besser davon zu kommen als andere Frauen in ihrer Situation.
Das Schicksal der Lotosblüte und ihrer Leidensgenossinnen stellt die Situation der zwangsprostituierten Frauen in Asien dar, die mit ihrer Hoffnung, durch einen reichen und zuvorkommenden Freier durch Heirat zu entkommen eigentlich letztlich helfen, dieses System zu erhalten. Chong Shim ist eine Dienende, und bleibt es auch nach ihrer Heirat.
Historisch beginnt die Handlung in der Zeit kurz vor dem ersten Opiumkrieg, allerdings bekommt man als Leser das Beiwerk nicht geliefert, sondern muss es sich genau wie die Reiseroute der Lotosblüte erarbeiten. Das ist mühsam, weil zum Beispiel Orte in alte chinesische Ortsnamen übertragen wurden und schwer auffindbar sind. Im Gegensatz dazu steht die wahrscheinlich durch die Übersetzung bedingte sehr einfache und moderne Sprache, die dem Buch in meinen Augen viel Authentizität nimmt.
Sehr detailliert und kalt beschreibt der Autor Landschaften, aber auch gewaltvolle Sexszenen, die dann im krassen Gegensatz zum angeblichen Lustempfinden der prostituierten Frauen in Zwangslage stehen - für mich ist das zum einen zu viel und zum anderen so absolut nicht nachvollziehbar und glaubhaft.
Ich weiß nicht, ob ich der asiatischen (Sprach)Kultur für diese Geschichte zu fern bin. Und ohne Recherche zu historischem Hintergrund wären sehr viele Informationen nur an mir vorbei geflogen, weil nur angedeutet. Ich denke, dass der Roman für Leser, die besser mit asiatischer Kultur und Geschichte vertraut sind als ich, gewinnbringend ist. Ich habe mich gestoßen an den nicht greifbaren Figuren, an Orten und Geschichtsdaten, mit denen ich erst beim Nachschlagen etwas anfangen kann und an der in meinen Augen nicht wirklich gelungenen Übersetzung aus dem Koreanischen.
Es ist durchaus interessant von Trostfrauen, Konkubinen und Mädchenhandel in Asien im 19.Jahrhundert zu lesen, aber für den nicht-asiatischen Buchmarkt wäre eine kurze Zeit- und Ortstafel sehr hilfreich gewesen.
Hwang Sok-Yong
Die Lotosblüte
Roman gebunden, 496 Seiten
Erschienen im Europa-Verlag
10.Mai 2019
ISBN 978-3-958902626
Preis 24,00 €